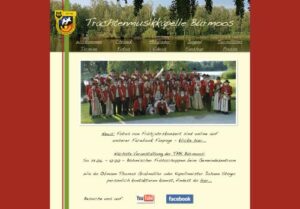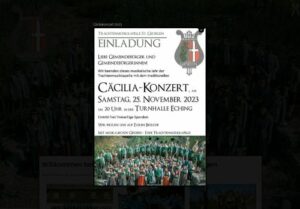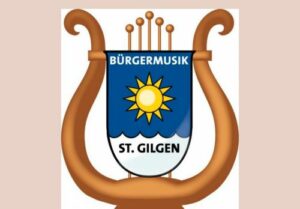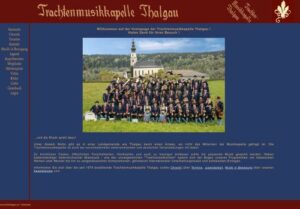In unseren 39 Flachgauer Musikkapellen musizieren derzeit 2.211 MusikerInnen, davon sind 1.147 unter 30 Jahre. Das ergibt einen Durchschnitt von 57 Mitgliedern pro Kapelle.
38 Musikkapellen unseres Bezirkes haben ein Jugend– bzw. Nachwuchsorchester.
Weiters bestehen bei einem Großteil unserer Musikkapellen zusätzlich diverse Kleingruppen und Ensembles.